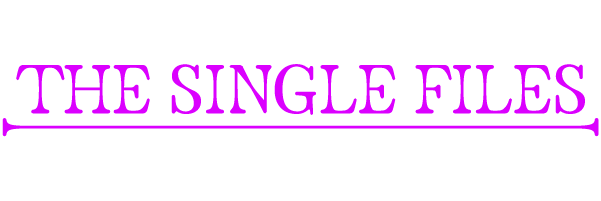Meine chronische Krankheit hat meine Einstellung zum Single-Leben verändert
Im vergangenen Herbst rettete mir ein Gespräch über Emily in Pariszufällig das Leben.
Es war spätnachts und ich war gerade mit einer meiner besten Freundinnen am FaceTimen. Wir diskutierten darüber, ob die Netflix-Serie eher in die Kategorie „So schlecht, dass sie schon wieder gut ist“ fiel oder eben einfach nur richtig, richtig schlecht war – und plötzlich… war da nichts mehr.
Etwa eine Stunde später kam ich wieder zu Bewusstsein, auf meinem Sofa liegend, während mein Hund im Badezimmer jaulte, mir eine Rettungskraft gerade Glucose-Gel in den Mund drückte und eine Freundin, die in der Nähe wohnte, nervös im Türrahmen stand.
WerbungWERBUNG
Nachdem sich mein Blutzucker wieder reguliert hatte und die Rettungskräfte gegangen waren, fragte ich meine Freundin, was passiert war. Sie erzählte, ich sei während meines Video-Calls mit der anderen Freundin in Ohnmacht gefallen; die wohnte allerdings sehr weit weg und hatte sofort unseren gesamten gemeinsamen Freundeskreis kontaktiert – inklusive der Freundin, die jetzt hier war, und meiner Schwester. Die hatte dann meine Eltern angerufen, die wiederum den Notdienst alarmiert hatten. Meine Nachbarschafts-Freundin war direkt zu mir gerannt und kam zeitlich mit dem Rettungswagen bei mir an. Während sie meinen nervösen Hund Marty beruhigte, kümmerten sich die Rettungskräfte um meine diesmal besonders ernste Hypoglykämie: Ich bin Diabetikerin, und mein Blutzuckerspiegel war völlig im Keller gewesen.
Dieses Erlebnis löste in mir zwei starke Reaktionen aus. Zuallererst war ich unheimlich dankbar für meine wundervollen Freund:innen und Familie, wie auch für die Geschwindigkeit und Effektivität der Kommunikation im 21. Jahrhundert. Zweitens machte sich in mir aber auch eine enorme Angst breit. Was, wenn ich nicht gerade via FaceTime mit jemandem gesprochen hätte? Was, wenn ich währenddessen einfach nur mit Marty kuschelnd ferngesehen hätte?
Riskiere ich durch meine Entscheidung, als Typ-1-Diabetikerin und Single allein zu leben, jeden Tag meine Gesundheit?
Wenn ich ehrlich bin, zerbreche ich mir über mein Singledasein nicht so oft den Kopf. Den Großteil meines Erwachsenenlebens habe ich alleine verbracht. Obwohl ich das zwar nicht als bewusste Entscheidung bezeichnen würde – ich bin einer Beziehung gegenüber immer offen, wenn alles stimmt –, habe ich mir zugegebenermaßen auch nicht viel Mühe gegeben, meinen Beziehungsstatus zu ändern, selbst vor Corona-Dating. Ich liebe meine Unabhängigkeit und genieße es, bei meinen Entscheidungen auf nichts und niemanden Rücksicht nehmen zu müssen. Bis auf Marty. Und, naja, meine Diabetes, schätze ich.
WerbungWERBUNG
Die Diagnose bekam ich mit 16, im vorletzten Schuljahr, während ich mich auf den Abschluss vorbereitete, gerade meinen Führerschein machte und mir überlegte, wo ich studieren wollte. Angesichts all dessen war es wohl kaum ein Wunder, dass ich meine Krankheit (eine unheilbare Autoimmunkrankheit, die mich bis ans Ende meiner Tage begleiten wird) irgendwann nur noch als nervige Last sah, für die ich eigentlich „keine Zeit“ hatte. Aber ich ließ mir einen Insulin-Plan aufstellen und lernte, meinen Blutzuckerspiegel zu managen. Trotzdem redete ich mir während dieser ersten Jahre ein, dieses „Problem“ würde schon irgendwann von selbst verschwinden, wenn ich es nur lange genug ignorierte. Konkret hieß das: Ich weigerte mich, darüber mit Freund:innen zu sprechen, tauschte meine (ziemlich große, auffällige) Insulinpumpe gegen Insulinspritzen aus und verheimlichte ernste Blutzuckerschwankungen vor meinen Eltern und Ärzt:innen.
17 Jahre, unzählige Fehler und mehrere Krankenhausaufenthalte später ist mir heute klar, wie naiv ich damals war. Jetzt, in meinen 30ern, frage ich mich langsam, wie meine nächsten Jahrzehnte auf diesem Planeten wohl aussehen könnten – und kann endlich zugeben, dass ich unheimlich Schiss davor habe, mir irgendwann mal eine falsche Insulindosis zu spritzen und dann bewusstlos, hilflos, völlig allein irgendwo rumzuliegen.
Seit meinem FaceTime-Fail bin ich vernünftiger. Ich benutze inzwischen wieder eine Insulinpumpe (und die sind inzwischen deutlich kleiner als 2004), zusammen mit einem Glucose-Monitor, der meinen Blutzucker den ganzen Tag lang überwacht und mich alarmiert, wenn mein Spiegel zu hoch oder zu niedrig ist. Ich weiß aber auch, dass der Umgang mit einer chronischen Krankheit nicht immer so glatt läuft, wie ich mir das vielleicht wünschen würde. Selbst wenn ich von jetzt an alles perfekt mache (unwahrscheinlich), selbst wenn ich von jetzt an nie wieder einen hypo- oder hyperglykämischen Schock erleide (unmöglich), kann und wird zwangsläufig vieles schief laufen. Und ohne eine:n Partner:in, der:die bei mir wohnt, befürchte ich, irgendwann mal Hilfe zu brauchen – und sie erst zu spät zu bekommen.
WerbungWERBUNG
Sollte ich mir also eine Beziehung suchen, nur weil ich mir Sorgen um meine Gesundheit mache? Nein, danke. Falls und wenn ich beschließe, eine Beziehung mit jemandem einzugehen, möchte ich das tun, weil ich es will. Nicht, weil ich Angst davor habe, was passieren könnte, wenn ich es nicht tue.
Stattdessen suche ich nach anderen Möglichkeiten, mich abzusichern – und das hat zu einigen interessanten Google-Suchen geführt, inklusive: „Wie bringe ich meinem Hund bei, den Kühlschrank zu öffnen?“, und: „Können Hunde den Notdienst rufen?“ Ich habe sogar recherchiert, wie ich an einen Notrufknopf für zu Hause kommen könnte, wie ihn Senior:innen manchmal haben. (Bevor du nachfragst: Es ist machbar, den als 30-Jährige:r zu bekommen, aber ganz schön aufwendig.)
Vielleicht klinge ich so, als hätte ich mich jetzt schon auf ein Leben ohne romantische Partner:innen eingestellt. Das ist nicht der Fall; trotzdem habe ich mich schon oft gefragt, ob mein Bedürfnis nach Unabhängigkeit jeder Beziehung im Weg stehen könnte. Je älter ich werde und je besser ich lerne, meine Krankheit mit der Ernsthaftigkeit zu behandeln, die sie verdient, desto überzeugter bin ich: Ich sollte mich selbst gesund und sicher halten können, ohne mich dabei auf andere verlassen zu müssen. Ich brauche keine Pflegekraft, und so möchte ich eine:n Partner:in auch nie betrachten. Genauso wenig will ich, dass meine Diabetes für diese Person zu einer Verantwortung, einer Verpflichtung wird. Meine Krankheit ist eine Herausforderung – aber keine unüberwindbare. Und sie ist bloß ein Teil von mir, nicht mein ganzes Ich. Wer mit mir zusammen ist, sollte das genauso sehen.
WerbungWERBUNG
Diese:n Partner:in habe ich aber noch nicht gefunden. Meine Angst, allein zu sterben – sowohl im sprich- als auch wortwörtlichen Sinn –, bleibt mir also erstmal erhalten. Jetzt gerade finde ich es aber wichtig, diese Angst anzuerkennen und ihr ein bisschen Platz einzuräumen. Sie zu verleugnen, hat mir und meiner Diabetes überhaupt nicht geholfen, und auch beim Dating halte ich das nicht für sinnvoll. Und während mir diese Angst weiter durch den Kopf schwirrt, wie ein Vogel, der das Fenster nicht findet, lasse ich sie trotzdem nicht über mein Leben, meinen Beziehungsstatus und mein zukünftiges romantisches Glück bestimmen.
Ich habe schon früh gelernt, meine Diabetes nicht als etwas zu beschrieben, das ich „bin“ – sondern als etwas, das ich habe. „Ich habe Diabetes“ fühlt sich ehrlich an; „Ich bin Diabetikerin“ überhaupt nicht. Und genauso geht’s mir mit „Ich bin ängstlich, weil ich alleine wohne“. „Ich habe Angst vorm Alleinwohnen“ hingegen? Damit kann ich leben.
WerbungWERBUNG