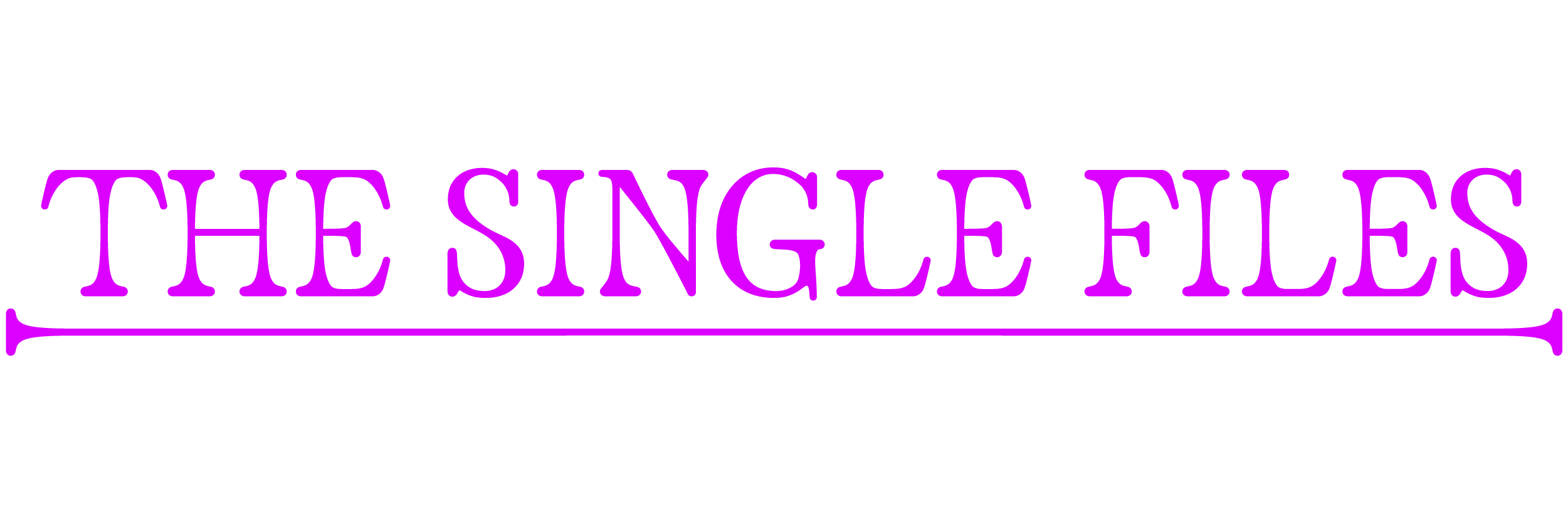Die Krankheit meines Vaters verlief in zwei Phasen – erst schleichend, dann ganz plötzlich. In der ersten kamen einige harmlose Erkrankungen zusammen, die wir automatisch seinem Alter zuschrieben: Bluthochdruck, hohe Triglycerid-Werte. Darauf folgten aber Schlag auf Schlag einige ernstere Diagnosen: Aortendissektion, Lungenembolie, Nierenkrebs.
Mein Vater starb in seinen 50ern dreimal fast. Das erste Mal war vor fünf Jahren, als ich 19 und für die Sommersemesterferien zu Hause war. Für einen Routine-Eingriff fuhr er morgens ins Krankenhaus und lag abends dann abgeschottet und voller Schläuche auf der Intensivstation. Sein konstanter Bluthochdruck, kombiniert mit seiner Gefäßverkalkung, hatte seine Arterienwände geschwächt. Die Wucht seines Blutes hatte also die innerste Schicht seiner Aorta aufgerissen, woraufhin Blut in die anderen Muskelschichten gelangt war. Die Infrastruktur seines Körpers kollabierte allmählich: Die Hinterlappen seiner Lungen fielen in sich zusammen und sorgten für immer mehr Gerinnsel. „Wie können Sie überhaupt noch aufrecht rumlaufen?“, fragte ihn eine Ärztin. Mein Vater zuckte nur mit den Achseln. „Mir geht’s okay.“
WerbungWERBUNG
Dieser Spruch wurde daraufhin zu seinem Refrain: Mir geht’s okay, ich habe einfach Glück! Aber nach seinem ersten Besuch auf der Intensivstation schwankte sein Gesundheitszustand so enorm, dass ich Angst hatte, mein Handy auf stumm zu stellen. Ich richtete mein Leben nach seinen MRTs und CTs und seinen Terminen bei Spezialist:innen. Ich lernte die medizinischen Fachtermini auswendig und ratterte sie vor seinen Ärzt:innen rauf und runter. Expertise vorzutäuschen gab mir das Gefühl von Kompetenz.
Als ich in meinem zweiten Studienjahr dann zum Campus zurückkehrte, implodierte ich: Ich sorgte dafür, dass ich absurd beschäftigt war. Meinen Kalender stopfte ich mit akademischen und sozialen Verpflichtungen voll, um mich davor zu drücken, meine Gefühle rund um die Gesundheit meines Vaters zu verarbeiten. Dating war da eine willkommene Abwechslung, und auch gleich etwas ganz Neues: Während der Schulzeit war ich den Typen gegenüber immer schüchtern gewesen, weil ich viel zu gestresst davon war, mich aufs Studium einzustellen. Das letzte Mal, dass ich jemanden als „meinen Freund“ bezeichnet hatte, war mit 14. An der Uni redete ich mir also ein, mein gesteigertes Interesse an Dating-Apps und wilden Partys sei einfach meine Art, verpasste Chancen nachzuholen.
Also datete ich – viel. Auf eine richtige Beziehung ließ ich mich aber nie ein. Ich sah zu, wie die Beziehungen meiner Freund:innen immer ernster wurden, während mein Liebesleben wie eine Art Morsecode wirkte: Immer wieder unterbrach ich lange Perioden der Enthaltsamkeit durch kurze, lockere Affären.
Als ich schließlich meinen Abschluss machte, fragte ich mich, ob ich vielleicht irgendeinen tief verwurzelten Makel hatte, der mich zu der Art Frau machte, die Männer zwar gerne dateten, mit denen sie sich aber keine Beziehung vorstellen konnten. Inzwischen lief das bei mir immer gleich ab: Rund um die Drei-Monats-Marke wurde die Stimmung zwischen uns kühler. Wir schrieben uns seltener, unterhielten uns schlechter. Meine längste Beziehung – obwohl wir nie offiziell „zusammen“ waren – hatte ich mit einem 14 Jahre älteren Psychiater. Der verwechselte mich einmal mit einer anderen Frau, die er gerade datete, und ich brach direkt in Tränen aus. Trotzdem traf ich mich danach noch zwei weitere Monate mit ihm. Ich vermute, dass sich ein Teil von mir fragte, ob er rausfinden könnte, was mit mir nicht stimmte.
WerbungWERBUNG
Dazu hatte ich ganz eigene Theorien: Vielleicht hatte ich ein Problem damit, mich an jemanden zu binden; vielleicht war ich emotional unverfügbar; vielleicht war ich zu anspruchsvoll – oder nicht anspruchsvoll genug. Einige dieser Selbstvorwürfe entsprachen vielleicht der Wahrheit, doch versuchte ich damit wohl einen viel schmerzhafteren Fakt zu kaschieren: Ich fühlte mich besonders zu Männern hingezogen, die es mit mir lieber oberflächlich hielten. Die nicht nachfragen würden, wieso mein Handy immer offen neben mir auf dem Esstisch liegen musste oder wieso ich mir nervös die Nagelhaut abzog. Dadurch konnte ich mich vor der Erklärung drücken, wieso ich den Grundriss des örtlichen Krankenhauses so gut kannte wie den meines ersten Wohnheims.
Während meines vierjährigen Studiums überraschte uns die Gesundheit meines Vaters mit einer Reihe von Plottwists. Auf den Riss seiner Aorta folgte eine erstaunlich schnelle Erholung, die allerdings durch die Nierenkrebsdiagnose, Metastasen und Blutgerinnsel in seinen Lungen und seiner Wade zunichte gemacht wurde. Manchmal öffnete ich seine Krankenakten im Unterricht, las mir seine medizinischen Beurteilungen durch, bis die Worte vor meinen Augen verschwammen und ich die Tränen kommen spürte. Ich verbrachte viel Zeit in der Krankenhauskapelle und betete.
Meine Probleme waren ein offenes Geheimnis. Ich hatte irgendwann damit angefangen, Essays darüber zu veröffentlichen, wie die Krankheit meines Vaters unsere Eltern-Kind-Dynamik auf den Kopf gestellt hatte. Zwar brauchte er im Alltag keine Unterstützung – sehr wohl aber bei Krankenhausterminen, wo er auf mich als Dolmetscherin angewiesen war. Als einziges Kind zweier Immigrant:innen war ich die logische Wahl für diese Rolle. Die einzige.
WerbungWERBUNG
Über mein privates Trauma zu schreiben, hatte es zwar für andere leicht zugänglich gemacht; trotzdem zögerte ich immer davor, meinen Dates von meinem Vater zu erzählen. Manchmal bat ich sie explizit darum, mich nicht zu googeln. „Dadurch verschiebt sich unser Machtverhältnis“, erklärte ich dann. „Wenn du meine persönlichen Essays liest, weißt du so viel mehr über mich als ich über dich.“ Das klang völlig logisch; gleichzeitig wollte ich aber auch nicht, dass meine potenziellen Partner meine Schwachstelle kannten – die Wunde, die sich nicht verschließen ließ. Hatte ich Angst davor, dass mich diese Männer als „kaputt“ sehen würden? Vielleicht. Gleichzeitig sorgte meine Bitte aber auch automatisch für Distanz in dieser neuen „Beziehung“. Durch das Schreiben verarbeitete ich meine Welt – ich schrieb auf, was ich nicht aussprechen konnte. All das waren Informationen, die ein möglicher Partner vermutlich über mich hätte wissen sollen, bevor sich zwischen uns wirklich etwas entwickelte. Indem ich diese Männer aber davon abhielt, meine Essays zu lesen, verhinderte ich die emotionale Intimität zwischen uns. Und das hieß wiederum, dass keine meiner Affären länger hielt als drei Monate.
Ein Teil von mir redete sich gern ein, dass meine Selbstsabotage ja einem höheren Zweck diente – der kindlichen Pflicht. Indem ich Single blieb, konnte ich für meinen kränklichen Vater die hilfreiche und aufmerksame Tochter sein. Trotzdem versagte ich in dieser Rolle immer wieder. Manchmal wurde mir sein Gesundheitszustand zu viel; dann vergrub ich mich tagelang in meiner Arbeit und ignorierte ihn. Zwischendurch vergaß ich Termine, oder ging bewusst nicht hin. Gleichzeitig war ich stolz darauf, wie gut ich schlechte Nachrichten inzwischen wegsteckte, um meinen Vater besser unterstützen zu können.
WerbungWERBUNG
Als die Corona-Krise losging, zog ich wieder nach Hause und war plötzlich viel aktiver an der Gesundheit meines Vaters beteiligt. Ich telefonierte mit der Apotheke, stritt mich mit seiner Versicherung und hielt ihm Predigten zu seinem eigenen Verhalten während der Pandemie – ich verbot ihm, das Haus zu verlassen, selbst maskiert und mit Handschuhen. Das alles war zwar nur ein Bruchteil dessen, was meine Mutter in den letzten vier Jahren geleistet hatte, aber mein Ehrgeiz gab mir das Gefühl, nützlich zu sein und zumindest einen Bereich meines Lebens kontrollieren zu können, während die Welt da draußen für meinen immungeschwächten Vater immer gefährlicher wurde.
Das letzte Mal, dass mein Vater fast starb, steckten wir mitten im ersten Corona-Sommer. Im Juli hatte er einen Routine-CT-Termin; der Scan zeigte aber, dass er überall riesige Blutgerinnsel hatte – in seinem Herzen, seiner Lunge, seinem Bein. Ich begleitete ihn in die Notaufnahme, hielt seine Hand und mich davon ab, zu weinen. Als ich am selben Abend aber mit meiner Mutter neben mir nach Hause fuhr, wurde mir bewusst, dass wir eines Tages denselben Heimweg antreten würden – am nächsten Morgen aber kein Patient im Krankenhaus mehr auf uns warten würde. Die Windschutzscheibe verschwamm vor meinen Augen, und ich fuhr rechts ran.
Ich weiß nicht, wann dieser Tag einmal kommt. Die Krankheiten meines Vaters sind nicht bloß chronisch, sondern auch unberechenbar. Zwischen seinen plötzlichen Krankenhausaufenthalten lagen teilweise Jahre. Dadurch ist jede Planung unmöglich und ich bin dazu gezwungen, mir vor jedem großen Lebensschritt dieselben Fragen zu stellen: Kann ich diesen Job annehmen, wenn er mich dazu zwingt, weit von meinem Vater wegzuziehen? Wenn ich mit diesem Mann zusammenkomme, hätte er dann Verständnis für meine nicht endende Angst um meinen Vater?
WerbungWERBUNG
An dem Tag, an dem ich meinem Vater endlich einen Impftermin buchen konnte, brach ich in Tränen aus – aus Erleichterung wegen seines baldigen Impfschutzes, und weil ich wusste, dass ich bald wieder von zu Hause wegziehen würde, um meinen Master-Abschluss zu machen. Die Distanz zwischen meinem Heimatort und meiner Uni ist zwar nicht groß, doch fühle ich mich von meinem Vater meilenweit entfernt, weil ich nicht mehr bei den Zoom-Gesprächen mit seinen Ärzt:innen dabei bin oder abends seinen Blutdruck messe. Die Schuldgefühle erdrücken mich geradezu.
Wie viele andere habe auch ich den Wunsch, die durch die Pandemie verlorene Zeit irgendwie wieder „wettzumachen“, indem ich Dates vereinbare, an Projekten arbeite und nach zukünftigen Jobs suche. Gleichzeitig mache ich mir Sorgen darüber, dass mich meine Zeit zu Hause irgendwie zurückgehalten hat; während meine Freund:innen zielstrebig auf Ehe und Hausbau zusteuern, habe ich immer noch Schwierigkeiten, mein Privatleben mit potenziellen Partnern zu teilen.
Ich hatte letztens ein zweites Date. Wir saßen an einem kühlen Abend zusammen in einer Bar, der Tequila erwärmte mir den Bauch, und er fragte mich plötzlich: „Wovor hast du am meisten Angst?“ Es war eine sehr direkte Frage. Mir gefiel seine Tendenz dazu, an der Grenze des sozial Akzeptablen zu kratzen. Ich hätte mir jetzt jede Menge Fake-Antworten ausdenken können, und sie schossen mir alle durch den Kopf. Vielleicht lag es am Tequila, oder vielleicht war ich es bloß müde, diesen Bereich meines Lebens zu verschweigen – diesmal antwortete ich aber ehrlich. „Mein Vater ist schon seit einer ganzen Weile krank.“ Ich verstummte und strich mit meinem Finger über das Kondenswasser an meinem Glas. „Es fällt mir schwer, mich jemandem zu öffnen oder glücklich mit ihm zu sein, wenn mein Vater jederzeit sterben könnte.“
WerbungWERBUNG
Er war kurz still. Dann tätschelte er mir das Knie. „Danke, dass du mir das erzählt hast“, sagte er. Sein lieber Ton überraschte mich. Er versuchte nicht, mich zu trösten, und verfiel auch nicht in unangenehmes Schweigen. Er hatte mir zugehört und dann das Thema gewechselt – die einzige Reaktion, die ich mir in dieser Situation gewünscht hatte. Mein Geständnis fühlte sich für mich an wie ein Meilenstein. Ich hatte ein kleines Loch in die Mauer gehauen, die ich um mich herum aufgebaut hatte, um mich vor emotionaler Intimität zu schützen.
Dabei hatte ich das Schwierigste ja noch gar nicht gestanden: Es war nicht so, dass ich mich nie jemandem nah oder glücklich fühlte. Diese Gefühle kamen und gingen, sogar oft: Bei einem ersten Date, wenn er beim Spaziergang nach meiner Hand griff; vor einem dritten Date, wenn ich mir unsere Nachrichten durchlas und lächeln musste; nach einem fünften Date, wenn ich neben ihm auf der Couch saß und die romantische Spannung in der Luft spürte. Ich war schon oft mit romantischen Möglichkeiten konfrontiert und nutzte sie häufig auch aus – jedes Mal fühlte sich das aber wie ein Verrat gegenüber meinem Vater an. Single zu bleiben, war für mich vielleicht eine Art der Selbstbestrafung. Hatte ich es schließlich überhaupt verdient, glücklich zu sein, wenn meine Familiensituation so zerbrechlich war? Wenn ich mich von einer echten, ersten Liebe überwältigen ließ, würde ich dann überhaupt genug Mitleid mit meinem Vater empfinden können?
In vielerlei Hinsicht sehe ich das Positive in meinem Single-Jahrzehnt. Weil ich nie in einer ernsten Beziehung steckte, bin ich sehr unabhängig und selbstständig geworden. Ich habe kein Problem mit dem Alleinsein und der Stille. Außerdem hatte ich dadurch die Freiheit, meine Zeit so einzuteilen, dass ich genug Aufmerksamkeit für meine Familiensituation parat hatte. Gleichzeitig habe ich gelernt, mich nur auf die Gegenwart zu konzentrieren, anstatt mir über zukünftige Katastrophen den Kopf zu zerbrechen. Obwohl ich mir noch nicht sicher bin, wann ich selbst eine Familie gründen will, habe ich schon jetzt ein erfüllendes Leben voller toller Freund:innen und persönlicher sowie beruflicher Projekte. Dieses Jahr fahre ich über die Feiertage nach Hause. Mein Vater und ich machen dann lange Autofahrten durch die Natur. Und wenn mich beim Familienessen jemand nach meinem Liebesleben fragt, weiß ich jetzt schon, was ich antworten werde: „Ich hab’s nicht eilig.“
WerbungWERBUNG